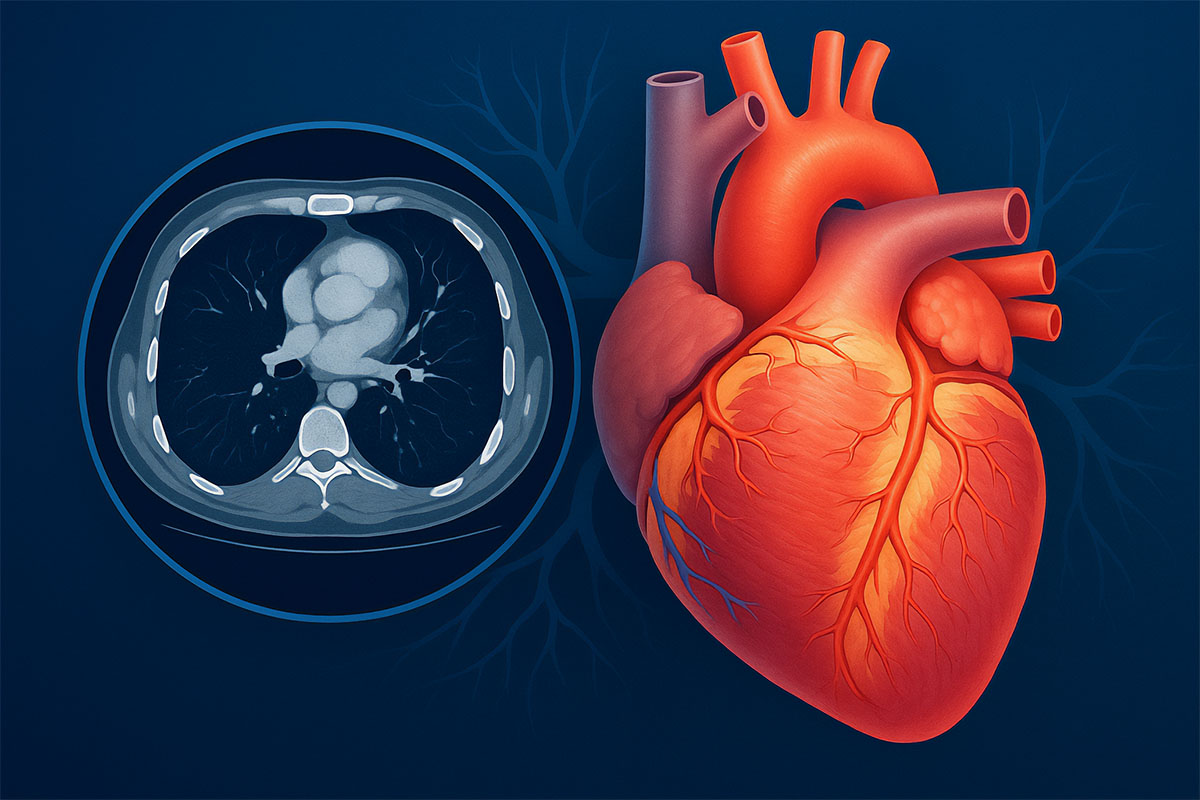Beschwerden wie Druck auf der Brust, Atemnot oder unklare Erschöpfung können viele Ursachen haben, von harmlosen Funktionsstörungen bis zu einer koronaren Herzerkrankung. Moderne Bildgebung hilft dabei, das Herz genauer zu untersuchen ohne gleich eine invasive Herzkatheteruntersuchung durchführen zu müssen. Doch wann kommt ein Herz-CT und wann ein Herz-MRT zum Einsatz?
In diesem Beitrag erklären wir die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Verfahren, wie sie ablaufen, wann sie laut Leitlinien empfohlen werden und was Sie als Patient*in erwarten können.
Schmerzen, Druck oder Stechen in der Brust: Ein häufiger Fall
Herr M., 56 Jahre, sportlich aktiv, Nichtraucher, bemerkt seit einigen Wochen ein unangenehmes Stechen in der Brust. Er hat den Eindruck, es tritt besonders bei Bewegungen und körperlicher Anstrengung auf. Sein Hausarzt veranlasst ein Belastungs-EKG, das zwar unauffällig ist, aber die Beschwerden bleiben. Um eine koronare Herzerkrankung (KHK) als Ursache sicher auszuschließen, soll eine weiterführende Bildgebung des Herzens angefertigt werden.
Es stellt sich die Frage: Herz-CT oder Herz-MRT?
Herz-CT: Schnell, präzise – und ideal zur Gefäßdarstellung
Das Herz-CT (Koronar-CT oder CT-Koronarangiografie) dient vor allem dazu, die Herzkranzgefäße sichtbar zu machen. Es zeigt, ob Ablagerungen oder Engstellen vorhanden sind, die den Blutfluss behindern könnten.
Wann wird das Herz-CT empfohlen?
Laut den europäischen Leitlinien (ESC 2019, DGK 2023) wird das Herz-CT insbesondere dann eingesetzt, wenn ein Verdacht auf eine koronare Herzerkrankung besteht, die Wahrscheinlichkeit dafür aber niedrig bis moderat ist. Auch wenn ein Belastungs-EKG unklar oder widersprüchlich ausfällt, kann das Herz-CT entscheidende Hinweise liefern. Zudem eignet es sich, wenn vor einem möglichen Herzkatheter zunächst eine nichtinvasive Abklärung sinnvoll erscheint. Auch bei Patient*innen mit erhöhtem Cholesterin oder familiärer Vorbelastung wird das Verfahren häufig genutzt, um das individuelle Herzinfarktrisiko besser einzuschätzen.
Die Untersuchung dauert meist nur wenige Minuten. Über eine Armvene wird ein Kontrastmittel verabreicht, damit die Gefäße sichtbar werden. Die Strahlenbelastung ist dank moderner Technik sehr gering. Besonders aussagekräftig ist der sogenannte Kalkscore, der das zukünftige Risiko für Herzinfarkt oder Durchblutungsstörungen beschreibt.
Vorteile und Grenzen des Herz-CTs
Das Herz-CT bietet eine schnelle und präzise Darstellung der Herzkranzgefäße. Ein unauffälliger Befund schließt relevante Verengungen nahezu sicher aus, was häufig hilft, unnötige Herzkatheteruntersuchungen zu vermeiden. Einschränkungen bestehen allerdings darin, dass Röntgenstrahlung und jodhaltiges Kontrastmittel verwendet werden – bei schwerer Niereninsuffizienz ist die Untersuchung daher nicht geeignet. Zudem kann die Aussagekraft bei stark verkalkten Gefäßen oder unregelmäßigem Herzrhythmus eingeschränkt sein.
Herz-MRT: Blick in den Herzmuskel
Das Herz-MRT ermöglicht einen detaillierten Blick auf das Herzmuskelgewebe und dessen Durchblutung – ganz ohne Röntgenstrahlen. Es zeigt Narben, Entzündungen, Herzmuskelschwäche oder Durchblutungsstörungen und liefert damit Informationen, die über die reine Gefäßdarstellung hinausgehen.
Wann wird das Herz-MRT eingesetzt?
Die Untersuchung wird vor allem empfohlen, wenn eine unklare Herzschwäche vorliegt oder der Verdacht auf eine Kardiomyopathie besteht. Auch bei einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung) oder zur Abklärung von Narben nach einem Herzinfarkt ist das MRT das Verfahren der Wahl. Außerdem kann es im Rahmen eines sogenannten Stress-MRTs zur Beurteilung der Durchblutung eingesetzt werden, wenn eine Ischämie – also eine Durchblutungsstörung – vermutet wird.
Stress-MRT: Herz unter „Belastung“
Beim sogenannten Stress-MRT wird über ein Medikament (meist Adenosin oder Regadenoson) die Durchblutung des Herzmuskels kurzfristig gesteigert. So lassen sich Areale erkennen, die unter Belastung schlechter durchblutet sind – ein Hinweis auf funktionell relevante Engstellen in den Herzkranzgefäßen. Im Gegensatz zum CT beurteilt das MRT also nicht nur die Struktur, sondern auch die Funktion des Herzens.
Vorteile und Grenzen des Herz-MRTs
Ein großer Vorteil des Herz-MRTs ist, dass keine Strahlenbelastung entsteht. Zudem erlaubt es eine exzellente Darstellung der Herzmuskelfunktion, von Narben und Entzündungen. Auch die Durchblutung kann in Ruhe und unter Stress beurteilt werden. Die Untersuchung dauert allerdings länger – meist zwischen 20 und 40 Minuten – und erfordert ruhiges Liegen sowie eine stabile Herzfrequenz. Bei Patient*innen mit Herzschrittmachern oder starker Platzangst kann die Durchführung eingeschränkt sein.
Zurück zu Herrn M.
Da das Belastungs-EKG unauffällig war und keine bekannten Vorerkrankungen bestehen, liegt die Vortestwahrscheinlichkeit für eine koronare Herzerkrankung im niedrigen bis mittleren Bereich. Nach Leitlinien ist hier das Herz-CT das Mittel der Wahl.
Das Ergebnis: Die Gefäße sind weitgehend frei, der Kalkscore liegt im Normbereich. Damit kann eine relevante KHK ausgeschlossen werden – ganz ohne Herzkatheter.
Fazit: Beide Verfahren ergänzen sich
Herz-CT und Herz-MRT sind keine konkurrierenden, sondern sich ergänzende Verfahren. Während das Herz-CT ideal ist, um die Gefäße schnell und präzise zu beurteilen – besonders bei unklarer KHK –, liefert das Herz-MRT wertvolle Informationen über den Herzmuskel selbst, seine Durchblutung, eventuelle Narben oder Entzündungen. Welche Untersuchung sinnvoll ist, hängt von den Symptomen, Vorerkrankungen und der klinischen Fragestellung ab. Oft entscheiden Radiolog*innen und Kardiolog*innen gemeinsam, welches Verfahren den größten Erkenntniswert bietet.
Beide Methoden liefern wertvolle Informationen: das Herz-CT als „Blick in die Gefäße“, das Herz-MRT als „Blick in den Herzmuskel“. Eine Zweitmeinung kann helfen, die Ergebnisse sicher zu interpretieren und die nächsten Schritte zu planen.
Auf einen Blick
|
Herz-CT |
Herz-MRT |
| Was wird untersucht? |
Darstellung der Herzkranzgefäße und Verkalkungen |
Beurteilung von Herzmuskulatur, Durchblutung und Narben |
| Wann empfohlen? |
Bei niedriger bis mittlerer Wahrscheinlichkeit für KHK
(Screening, Abklärung unklarer Brustschmerzen) |
Bei Herzmuskelerkrankungen, Myokarditis oder Verdacht auf Ischämie (Stress-MRT) |
| Untersuchungsdauer |
Ca. 5–10 Minuten |
Ca. 20–40 Minuten |
| Strahlenbelastung |
Gering (Röntgenstrahlen) |
Keine Strahlung |
| Kontrastmittel |
Jodhaltig |
Gadoliniumhaltig |
| Hauptvorteile |
Schnell, präzise Gefäßdarstellung, sehr guter Ausschluss einer KHK |
Detaillierte Analyse der Herzfunktion, Narben und Durchblutung unter Stress |
| Häufige Anwendung |
Abklärung stabiler Brustschmerzen oder auffälliger Laborwerte |
Beurteilung von Herzmuskelschäden, Entzündungen oder Ischämien |
Medizinisch geprüft von Dr. med. D. Schroth, Facharzt für Radiologie ·
Zuletzt aktualisiert am 9. Oktober 2025